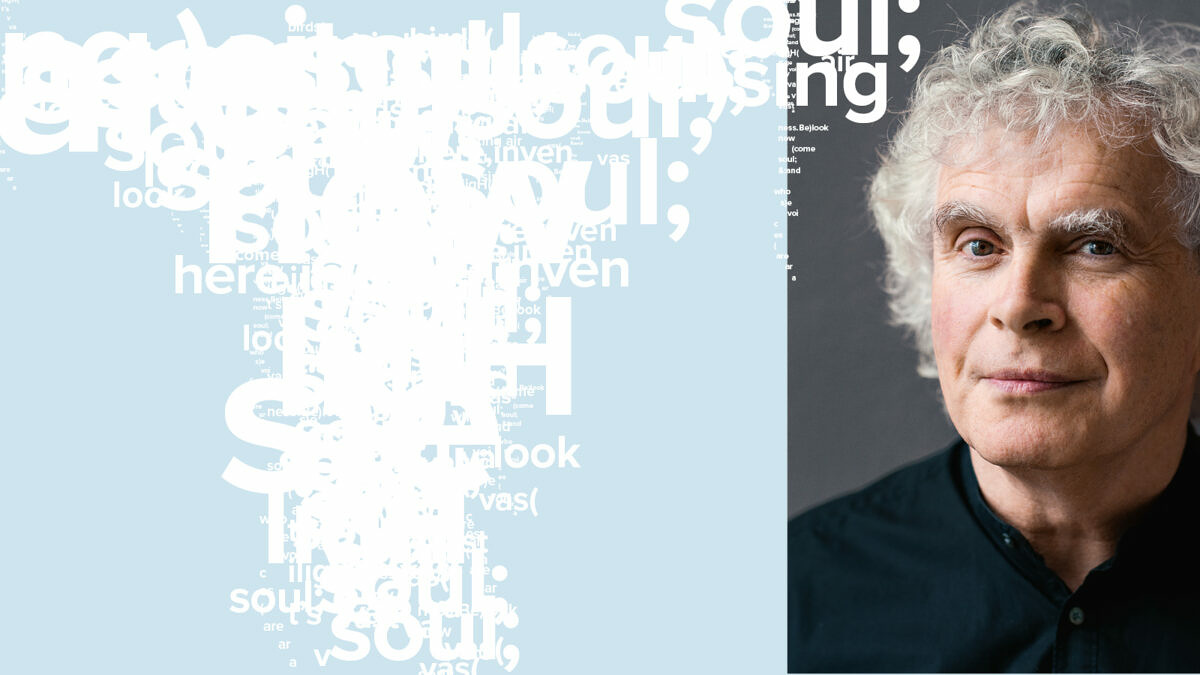Psychogramm der Einsamkeit
Alfredo Catalanis »La Wally« zwischen Realismus und Mythos. von Florian Heurich
Entstehung des Werks: Frühjahr 1889 – Frühjahr 1891. Uraufführung: Januar 1892 am Teatro alla Scala in Mailand. Lebensdaten des Komponisten: *19. Juni 1854 in Lucca (Toskana); † 7. August 1893 in Mailand
Es war Alfredo Catalanis Pech, dass er genau zu einer Zeit des Übergangs lebte und wirkte. Eine alte Komponistengeneration mit Giuseppe Verdi an der Spitze beherrschte nach wie vor die italienische Opernlandschaft, und die jungen Neuerer, allen voran Giacomo Puccini, erarbeiteten sich langsam ihren Platz. Verdi hatte das italienische Melodramma des 19. Jahrhunderts auf einen Höhepunkt geführt und damit neue Türen aufgestoßen, Puccini brachte schließlich den um 1900 aufgekommenen Verismo in veredelter Form auf die Bühne und wurde zur zentralen Figur des frühen 20. Jahrhunderts. Catalani stand dabei exakt in der Mitte. Thematisch griff er in Opern wie Dejanice (1883), Edmea (1886) oder Loreley (1890) vor allem historische oder romantisch-fantastische Stoffe auf, während er sich musikalisch doch sehr modern und bisweilen sogar relativ wenig italienisch zeigte. Verdi soll La Wally sogar einmal »eine deutsche Oper ohne Herz und Inspiration« genannt haben.
Dass sich Catalani nie richtig neben seinen Zeitgenossen behaupten konnte, lag sicher auch daran, dass sein Verleger Giulio Ricordi vor allem auf Puccini setzte und diesen förderte, Catalani hingegen eher vernachlässigte. »Ich verheimliche nicht, dass mir die Galle aufsteigt, wenn ich sehe, was gerade passiert, und mich erschreckt die Vorstellung, wie meine Zukunft aussehen könnte, jetzt, wo es nur einen einzigen Verleger gibt und dieser Verleger möchte, dass man von niemand anderem als Puccini spricht. Puccini muss der Nachfolger von Verdi werden«, so Catalani.
La Wally entstand zwischen 1889 und 1891 und damit relativ zeitgleich mit Mascagnis Cavalleria rusticana, dem Prototyp der veristischen Oper. Dies mag dazu geführt haben, dass La Wally auch oft mit dem Verismo in Verbindung gebracht wurde. Wegen des Schauplatzes im ländlichen Milieu, der überbordenden Leidenschaften und wegen eines gewissen musikalischen Lokalkolorits zur Charakterisierung des Lebens in den Tiroler Bergen. Vielmehr erscheint La Wally jedoch mit ihrer überhöhten und in ihrer heroischen Größe fast mythisch wirkenden Titelfigur als eine Legende aus einer unbestimmten, archaischen Vergangenheit, ähnlich wie zuvor schon Loreley. Dabei sind die Schauplätze – sowohl die »zivilisierten« in der Dorfgemeinschaft als auch die »unzivilisierten« in Schnee und Eis des Hochgebirges – nicht realistische Milieu- oder Naturschilderungen, sondern vor allem ein Spiegel von Wallys innerer Einsamkeit: unter Menschen, wo sie als Außenseiterin gilt, genauso wie in der entlegenen Wildnis. Sogar die berühmteste Arie der Oper (»Ebben? Ne andrò lontana«), mit der sie ihren Abschied von der menschlichen Welt besiegelt, ist nicht eigens für La Wally komponiert, sondern Catalani verwendete hier die Melodie eines Klavierliedes aus dem Jahr 1878 wieder, der Chanson groënlandaise auf einen Text von Jules Verne. Und ebenso wenig, wie diese Melodie Grönland charakterisiert, so wenig beschreibt sie die Tiroler Bergwelt. Sie bringt vielmehr einen Seelenzustand zum Ausdruck.
Catalani wurde wie Puccini in Lucca geboren, rund vier Jahre vor diesem am Juni 1854. In der Jugend gab es einige Berührungspunkte: Catalani studierte zunächst am Musikinstitut seiner Heimatstadt, an dem auch Puccini seine erste Ausbildung erhielt; sein Lehrer war Fortunato Magi, ein Onkel Puccinis, der auch seinem Neffen Unterricht gab. Verständlich also, dass Catalani später Puccini immer in gewisser Weise als Rivalen empfand, der die größere Karriere machte. Aber auch Puccini erkannte seinen Landsmann aus Lucca als ebenbürtigen Konkurrenten an und nannte ihn nach dessen Tod einen »großartigen, aber glücklosen Künstler, […] eine bleibende Erinnerung, die sich in die Seele eines jeden Italieners einbrennt, der alles Zarte und Poetische zu schätzen und zu lieben weiß«.
Später ging Catalani für ein Jahr nach Paris, und der Einfluss der französischen Musik hinterließ auch Spuren in seinem Kompositionsstil. Schließlich beendete er seine Studien in Mailand, wo er sich der Scapigliatura anschloss, einer freigeistigen und unangepassten Künstlergruppe rund um den Literaten und Komponisten Arrigo Boito, die eine kulturelle Reform propagierte. Boito war auch der Librettist von Catalanis erster Oper La falce (1875), dies sollte jedoch das einzige gemeinsame Bühnenwerk bleiben. Seinen größten Erfolg erzielte Catalani 1890 mit Loreley, einer Umarbeitung seiner 1880 uraufgeführten Oper Elda, in der er die Loreley-Legende noch vom Rhein an die Ostsee verlegt hatte.
Nachdem Catalani auf Empfehlung Boitos auf den Roman Die Geier-Wally von Wilhelmine von Hillern aus dem Jahr 1873 gestoßen war, konnte er Luigi Illica gewinnen, um daraus ein Libretto zu machen. Diesen musste er jedoch aus eigener Tasche bezahlen, da es keinen konkreten Kompositionsauftrag für die neue Oper gab. Nur eineinhalb Jahre nach der Uraufführung an der Mailänder Scala starb Catalani mit 39 Jahren an Tuberkulose, an der er schon längere Zeit litt. Bereits in früheren Jahren war er mehrfach zur Erholung in die Schweizer Berge gereist. Das Ambiente der Alpen, in dem La Wally spielt, war ihm also bestens vertraut, und selbst wenn er in seiner Oper musikalisches Lokalkolorit nur sehr dezent und gezielt aufblitzen lässt, so war er doch darauf bedacht, dass auf der Bühne eine möglichst realistische Szenerie entworfen wurde. Er fuhr mit dem Bühnen- und Kostümbildner der Uraufführung sogar nach Tirol, um sich inspirieren zu lassen.
Das Sujet passte bestens zur Ästhetik und zu den Themen, die den Mitgliedern der Scapigliatura gemeinsam waren: unmögliche Liebe, ein Hang zur Selbstzerstörung, ein mythisch verklärtes Zentral- oder Nordeuropa und Letzteres auch auf musikalischer Seite durch eine Hinwendung zur deutschen Musiktradition, insbesondere zu Wagner. So finden sich in La Wally mit Ausnahme von Orchestervorspielen oder Bühnenliedern, wie etwa dem vom Zitherspieler Walter gesungenen Lied vom Edelweiß im I. Akt, kaum mehr geschlossene Formen. In der Musik wechseln sich rezitativische und ariose Passagen ab, wobei Gesangsstimme und Orchester gleichberechtigte Partner sind. Das Lied vom Edelweiß ist auch einer der wenigen Momente, in denen Catalani die Atmosphäre Tirols heraufbeschwört. Pizzicati der Streicher imitieren die Zither, und Walters Gesang erinnert an einen Jodler, wenn auch in höchst stilisierter Form. Wenig später wird das Herannahen der Jäger musikalisch illustriert, danach präsentiert sich Hagenbach mit seiner Erzählung, wie er einen Bären geschossen hat. Es ist keine Auftrittsarie im herkömmlichen Sinn, sondern ein eher rezitativisches Arioso. Der weitaus spektakulärere Auftritt gehört der Titelfigur. Das Orchester kündigt das Erscheinen Wallys mit einem Allegro vivo aus schnellen absteigenden Skalen an; fast wie eine Naturgewalt betritt sie die Szene und bringt mit ihren strengen und aufgebrachten ersten Worten den vorangegangenen Streit zwischen Hagenbach und ihrem Vater Stromminger zum Erliegen. Wally hat damit einen ähnlich effektvollen Auftritt, wie ihn später Minnie in Puccinis La fanciulla del West haben wird.
Gerade im I. Akt zeigt sich Catalani besonders modern in seiner Klangsprache und im musikdramatischen Aufbau. Nachdem Schauplatz, Gesellschaft und die Protagonisten vorgestellt worden sind, leitet ein kurzes Orchesterzwischenspiel in den Teil des Aktes über, in dem es um die zwischenmenschlichen Konflikte geht: Wallys Liebe zu Hagenbach, die Eifersucht Gellners, die väterliche Autorität Strommingers und schließlich Wallys Einsamkeit und innere Stärke, die in ihrer Arie »Ebben? Ne andrò lontana« zum Ausdruck kommen.
Im II. Akt steuert alles auf den finalen »Kusstanz« zu. Catalani war eigens dafür ins Ötztal gereist, um die dortigen Traditionen und lokalen Tänze zu studieren. Aber auch dieser Tanz im Stil eines Ländlers ist ein Beispiel dafür, wie Catalani sich zwar von der Realität inspirieren ließ, diese aber überhöht und zu einer Kunstwelt macht, zumal der Brauch, beim Tanzen der sich sträubenden Partnerin einen Kuss abzugewinnen, eine Erfindung des Librettisten Illica ist. Im Ötztal gibt es einen solchen Brauch nämlich nicht. Kurz zuvor hat Wally in einem emphatischen Arioso eingestanden, dass sie noch niemals geküsst wurde (»Finor non m’han baciata«), und am Ende des Aktes wird sie genau durch ihren ersten Kuss zum Gespött der anderen. Damit sind ihre Rachegelüste geweckt und die Katastrophe ist besiegelt.
Der III. Akt beginnt mit einem Orchestervorspiel, das den Titel A sera (Am Abend) trägt und schildert, wie die Leute vom Fest heimkehren und auch Wally zusammen mit Walter aufgewühlt in ihr Haus zurückkommt. Dieses Stück hatte Catalani zuvor für Klavier und in einer Bearbeitung für Streichquartett komponiert und dann in seine Oper übernommen. Der ferne Gesang des »Pedone di Schnals«, des Wanderers aus Schnals, der bereits im II. Akt als eine Art mythisch warnende Figur aufgetreten ist, bildet hier den Kontrast zu Wallys Seelenzustand. Dieser kommt ein weiteres Mal in ihrer Arie »Né mai dunque avrò pace?« (»Ach, nimmer findet Frieden meine Seele«) zum Ausdruck. Überhaupt stehen in diesem Akt auf raffinierte Art und Weise das Innere von Wallys Haus und das Äußere der Straße mit Brücke und Bach, wo sich der Mordanschlag auf Hagenbach abspielt, gegenüber. Schließlich symbolisiert die Melodie von »Ebben? Ne andrò lontana« Wallys endgültigen Abschied von der Welt.
Eine Atmosphäre der absoluten Trostlosigkeit und Einsamkeit beherrscht den IV. Akt. Wally, die schon immer eine nach Freiheit strebende Außenseiterin war, hat die Zivilisation verlassen, und in Schnee und Eis ist nun selbst die Natur tot. »Die Szene, die sie umgab, glich in dem traurigen und bleichen Dezember einem Friedhof, mit Schneehügeln bedeckt, mit Laub, das bizarr aus Eis zu Kreuzen geformt worden war«, so beschreibt Wilhelmine von Hillern diese Szenerie in der Geier-Wally. Im finalen Duett mit Hagenbach blitzen kurze, utopische Hoffnungsschimmer in die feindliche Natur, und nachdem diese den Geliebten dahingerafft hat, bäumt sich Wally ein letztes Mal auf und folgt ihm in den Tod. Gleichzeitig wird sie, die selbst mehr archaische Naturgewalt als reale Frau ist, eins mit der Natur. »Aprimi le tue braccia« (»Breite deine Arme für mich aus«) sind ihre finalen Worte, und es ist nicht ganz klar, ob sie damit den Geliebten oder doch den Schnee meint, in den sie sich stürzt und den sie ihr »candido destino«, ihr »weißgewandetes Schicksal« nennt.
Trotz der realistischen Schauplätze und Situationen, die bisweilen sogar durch Anklänge an die Tiroler Volksmusik illustriert werden, bleibt La Wally bis zum Schluss eine Oper, in der der Realismus mythisch überhöht wird. Ein Bindeglied zwischen dem Melodramma des 19. Jahrhunderts und der italienischen Moderne.