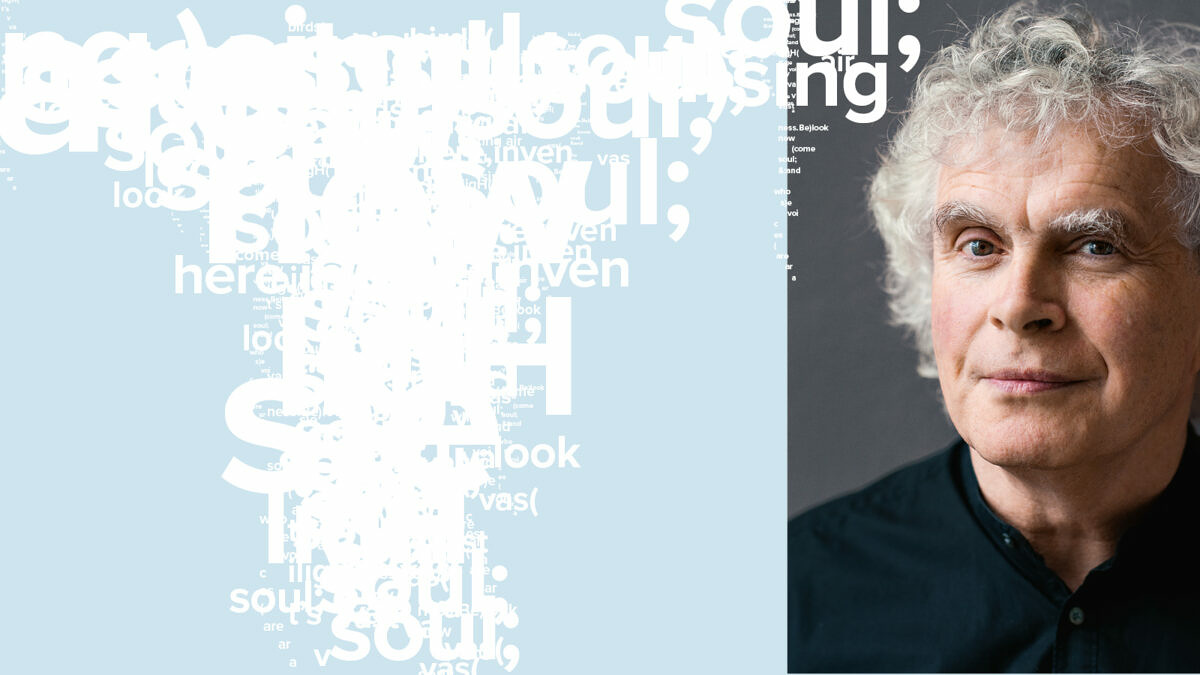Kreuzwege
Konzerteinführung: 19 Uhr
Vorverkauf ab Di., 9. Juli 2024.
Ab diesem Zeitpunkt erreichen Sie hier den Online-Ticketverkauf.
Dieses Konzert ist Teil des Chor-Abonnements.
Infos zur Abonnementbuchung finden Sie hier.

Programm
Mitwirkende
Wer wagte es, nach Bach noch eine Passion zu komponieren? Zu den alternativen musikalischen Annäherungen zählt Via crucis von Franz Liszt, deren 14 Sätze mit einem einleitenden Hymnus die Stationen des Kreuzweges mit Solisten, Chor und Klavier ausdrucksstark nachzeichnen. Das menschliche Drama von Armut und Verlassen-Sein, das im berühmten Märchen von Hans Christian Andersen um ein Schwefelhölzer verkaufendes Mädchen traurige Gestalt annimmt, bildet die literarische Vorlage für die »Passion« des Pulitzer-Preisträgers David Lang. In seiner Little Match Girl Passion von 2007 bringt er den Leidensweg des Mädchens mit mystischen Visionen und Texten aus Bachs Matthäus-Passion in unsere Zeit.