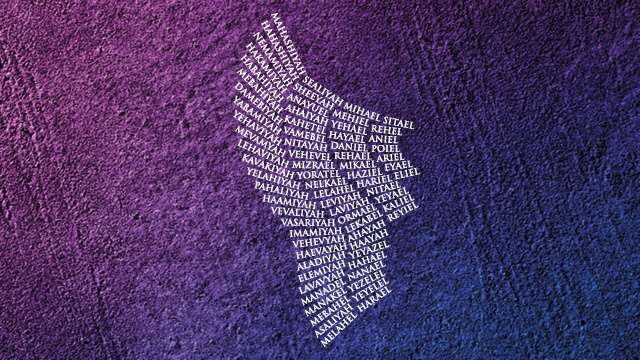O Gott! So könnte der Urknall der Musik lauten. Ein Mensch erhebt die Stimme, um gehört, geliebt, gerettet zu werden. Er ruft einen abstrakten Titel an: Herr, Kyrie, Domine. Oder einen Namen. Der Schriftsteller und Theologe Johann Gottfried Herder, dessen Name heute nur noch selten angerufen wird, erkannte darin sogar den Ursprung der Musik: »Wir finden uns nämlich so ganz umringt von ungeheurer Macht und Übermacht der Schöpfung, dass wir in ihr nur wie Tropfen im Ozean zu schwimmen scheinen; und wenn dies Gefühl über einen Gegenstand oder in einer Situation zur Sprache kommt, was kann es anders, als ein Ausdruck des Seufzers werden: ›Ungeheure Macht, erdrücke mich nicht! Hilf mir!‹« Im Laufe der Zeit aber, in der Geschichte der Religion, der Kultur, der Musik, werde dieser Ausruf immer beredter, persönlicher und präziser, lehrt Herder: »Er nennt die Eigenschaften seines angebeteten Gegenstandes mit tausend Namen, deren ganzer Inhalt dieser ist: ›Du bist groß; sei auch gut! Schade mir nicht, hilf mir!‹«
Lera Auerbach nennt keine tausend, aber 72 Namen, einen nach dem anderen: Sie sind ihr Text und ihr Thema, ihr Libretto und ihre Liturgie, nichts sonst ist zu hören – keine Dichtung, keine Handlung, keine Erzählung. Nichts anderes, nur diese 72 Namen (und ein Amen als Epilog). Gleich im Inhaltsverzeichnis der Partitur werden sie aufgeführt, von Vehevyah auf Seite 10 bis Mevamyah auf Seite 259. Unbekannte, unvertraute Namen, die noch rätselhafter erscheinen, noch fremdartiger klingen, wenn man begreift, dass es sich um Engelsnamen handelt. Und so heißt auch das ganze Werk: 72 Engel, eine ununterbrochene Folge von »Beschwörungspräludien«, von Anrufungen der ungeheuren Macht, die helfen oder erdrücken kann und die sich nur in Zwischenwesen, Geistesblitzen, Botenstoffen mitteilt. Ob die Engel umherfliegen und deshalb Vogelflügel benötigen, ob sie verspielte Kleinkinder, lockige Jünglinge oder gepanzerte Drachentöter sind, bleibt eine Glaubens- und Geschmacksfrage. Der Grenzübergang zwischen Theologie und Esoterik, Kunst und Kitsch steht ohnehin weit offen.
»Engelwesen, spirituelle Führer, höhere Energien oder Boten sind ein allgemeines Thema in vielen Glaubenssystemen der Menschheitsgeschichte«, betont Lera Auerbach und erinnert daran, dass es neben den Engeln der drei abrahamitischen Religionen – Judentum, Christentum, Islam – auch die Himmelswesen, Geister und Halbgötter des Buddhismus und Hinduismus gibt, die Devas und Apsaras, oder die Amschaspand, die unsterblichen Weisen der Religion Zarathustras. Auerbach will mit ihren 72 Engeln gerade die Gemeinsamkeiten der historischen Schöpfungsriten und Jenseitskulte herausstellen, sie will herausfinden, »was die verschiedenen Kulturen in ihren religiösen, spirituellen, esoterischen und mythologischen Traditionen« eint, nicht was sie trennt. Über Jahrhunderte sind Religionen als Machtfaktor und Kriegsparteien aufgetreten, als autoritäre Regime. Aber Auerbach kapituliert nicht vor der Geschichte, sie sucht mit dem Ursprung der Musik auch den Ursprung des Glaubens, den Wendepunkt der Befreiung, wie er sich legendär im Auszug Israels aus der ägyptischen Gefangenschaft darstellt. Auf eben dieses Ereignis der biblischen Erzählung spielt sie an, wenn sie schreibt: »Im Wesentlichen handelt es sich bei den 72 Engeln um ein langes, intensives Gebet voller Leidenschaft und Hoffnung. Vielleicht setzt sich der Exodus heute in jedem von uns fort, wenn wir uns von unseren Fesseln beschränkter Vorurteile und vorgefasster Meinungen befreien.«
Auerbach beruft sich nicht von ungefähr auf das Buch Exodus, das Zweite Buch Mose aus der hebräischen Bibel (dem Alten Testament). Im vierzehnten Kapitel wird der Zug der Israeliten durch das geteilte Schilfmeer beschrieben, die göttliche Rettung vor der feindlichen Streitmacht der Ägypter. So lesen sich die Verse 19 bis 21 an der Oberfläche: »Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, und stellte sich hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und dort war die Wolke finster, und hier erleuchtete sie die Nacht, und so kamen die Heere die ganze Nacht einander nicht näher. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der HERR zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken, und die Wasser teilten sich.«
Unter oder in diesem Wortlaut aber entdeckte im 13. Jahrhundert der von der katholischen Kirche verfolgte sephardische Rabbiner und Mystiker Abraham Abulafia einen verborgenen Sinn: die verschlüsselten Namen der Engel, mit deren Anrufung Mose das Wunder der Errettung heraufbeschworen haben soll. Abulafia las die drei Verse als Bustrophedon, also »furchenwendig«, von rechts nach links, von links nach rechts, von rechts nach links. Jeder Vers umfasst im hebräischen Original 72 Buchstaben. Indem der Gelehrte diese Verse übereinanderlegte, je drei Buchstaben von oben nach unten verband und mit den Namensendungen -el oder -yah abrundete, ergaben sich aus dieser Kombination die verschwiegenen Namen der 72 Engel, die Israel aus der Sklaverei zur Freiheit geleiteten.
Diese Entdeckung der 72 Engelsnamen liegt folglich achthundert Jahre zurück. Die ersten Ideen und Skizzen zu ihren 72 Engeln wiederum notierte Auerbach vor über zwanzig Jahren, noch im letzten Jahrhundert, aber für lange Zeit spielte die Musik nur in ihren Gedanken, da sich kein Dirigent fand, der den abendfüllenden Zyklus der 72 Präludien aufführen wollte. Von Anfang an dachte Auerbach an ein Chorwerk. Die Mitwirkung eines instrumentalen Ensembles aus Sopran-, Alt-, Tenor- und Baritonsaxophon kam ihr erst später in den Sinn, nachdem sie mit dem Raschèr Saxophone Quartet zusammengearbeitet hatte. Diese Entscheidung veränderte den Charakter der evokativen Musik grundlegend, weil die vier Saxophone zwar auch gemäß der kirchenmusikalischen Tradition behandelt und »colla parte« zur Intensivierung der Vokalstimmen geführt werden und außerdem den kontrapunktischen Satz und klassischen Konversationsstil eines Streichquartetts imitieren. Vor allem aber erweitern sie das Klangspektrum und den Ausdrucksradius des Chorgesangs elementar. Sie können bedrohlich brüllen wie wilde Tiere, sagt Auerbach, oder delikat intonieren wie die »Harmoniemusik« der Holzbläser oder mystisch surreale Schwebeklänge erzeugen wie eine Glasharmonika. Mit einer gezielten Als-ob-Ästhetik, einer frappierenden Verwandlungskunst lässt Auerbach die Saxophone obendrein konfessionelle Szenerien und biblische Mythen wachrufen. Ausdrücklich schreibt sie am Anfang und immer wieder in die Partitur, das Saxophon solle markerschütternd tönen wie das Schofar, ein Widderhorn, das im Alten Testament als ein kultisches Instrument geschildert wird, dessen durchdringender Ton Angst und Schrecken verbreitet oder Jubel und Triumph verkündet. Die Saxophone sollen aber auch schmettern wie die Trompeten, die bekanntlich Stadtmauern zum Einsturz brachten und eines Tages das Jüngste Gericht ankündigen werden. Oder ihr Spiel weht herüber wie der ferne Klang einer Kirchenorgel, eine romantische Vorstellung, denn der Standort des Hörenden befindet sich folgerichtig außerhalb des Gotteshauses, im Vorübergehen, auf der Suche, bei einer Heimkehr. Da schließlich das Saxophon unweigerlich jazzig-afroamerikanische Assoziationen auslöst, lenkt Auerbach einzelne der Präludien stilistisch in die Nähe des Spirituals – die Chorsängerinnen und -sänger werden sogar ausdrücklich zum Mitswingen eingeladen. Und überhaupt: »Jeder Engel ist anders und besitzt eine unverwechselbare Persönlichkeit, sowohl geistlich als auch musikalisch«, erklärt Lera Auerbach.
Obgleich sie ihre »Beschwörungspräludien« als Meditationen über die esoterischen Namen der Engel versteht, als Innenansichten, gleichen einzelne dieser Sätze Charakterporträts, Episoden, Miniaturdramen oder Psychogrammen. Wer spricht? Der Mensch, der die anonyme Macht über sein Leben zu fassen hofft (»lamentoso« lautet die häufigste Vortragsbezeichnung in Auerbachs Partitur, »klagend«), oder der Engel, der aus einer unvorstellbaren Zwischensphäre antwortet? Oder spricht der eine nur im anderen? Untrennbarkeit ist jedenfalls das höhere Prinzip dieser Komposition, die Auerbach keinesfalls als eine Suite oder Perlenkette von beziehungslosen Einzelstücken missverstanden wissen will: »Die 72 Präludien sind eng miteinander verknüpft und folgen ohne Pause aufeinander, wodurch man sie als eine zusammenhängende Komposition, weniger als 72 einzelne kurze Präludien wahrnimmt«, sagt Auerbach. »Strukturell gliedert sich das Werk bei Präludium 36 in zwei Teile und bei Präludium 24 und 48 in drei Teile. Dies stellt Einheit und Teilung gleichzeitig dar: zwei in einem (Dualität) und drei in einem (Trinität). An diesen Schnittstellen werden alle der bisher eingeführten Engelsnamen rezitiert. Das Werk endet mit ›Amen‹, einer ruhigen Meditation als Postludium.« Die dennoch von einer irritierenden Unruhe und Spannung erfüllt ist, von einer qualvollen Expressivität, die abermals mit dem Attribut »lamentoso« bezeichnet wird, bevor die Klage zuletzt erstirbt und ein virtuell endloser Triller im Altsaxophon den letzten Takt ins Offene weitet: »um den Eindruck eines ewig verklingenden Tons zu erzeugen«, wie die letzte Anmerkung in der voluminösen Partitur lautet. Am Ende löst sich die Musik in Nichts auf. Oder im All. Oder im Anfang: Das Amen, sagt Auerbach, »baut auf der Obertonreihe auf, die der Ursprung aller Klänge ist«.
Und schließlich fanden sich doch Dirigenten, die Auerbachs Engel aufführen wollten, angefangen mit Peter Dijkstra, der am 3. November 2016 in Amsterdam die Weltpremiere leitete: mit dem Nederlands Kamerkoor und dem Raschèr Saxophone Quartet. Aber damit war die Geschichte noch nicht am Ende. Lera Auerbach, die 1973 in Tscheljabinsk im Ural geborene Komponistin, Pianistin, Schriftstellerin und bildende Künstlerin, die in New York an der Juilliard School und der Columbia University und in Hannover an der Musikhochschule studiert hat – sie ließ den 72 Engeln noch im selben Jahr eine Komposition für Chor und Streichquartett über 72 Dämonen folgen. »In splendore lucis« (»Im Glanz des Lichts«) lautet der Untertitel des einen, »In umbra lucis« (»Im Schatten des Lichts«) der des anderen Werks. Auerbach vergleicht Engel und Dämonen mit den zwei Seiten derselben Medaille. »Die Dämonen kommen uns näher, die Engel sind entrückter«, weiß Auerbach. Und die Engel – »sie sind die Namen Gottes, seine Heerscharen, seine Krieger, die Gerechten. Und genau aus diesem Grund droht ihnen ein tiefer Fall. Weil Selbstgerechtigkeit zu Überheblichkeit und Eitelkeit verführt – und somit zu gefallenen Engeln. Zu Dämonen.«